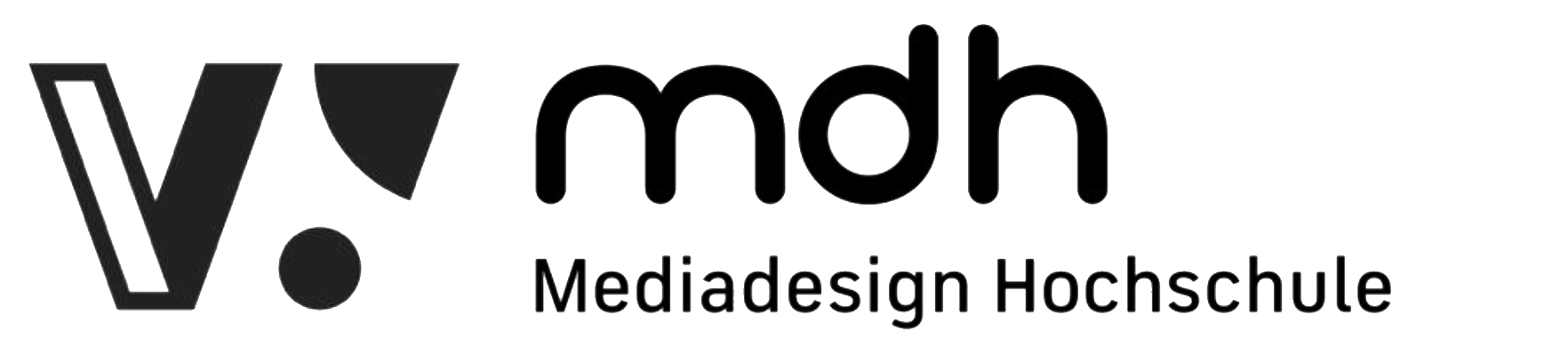Games are coming out
19.08.2008
Computerspiele gelten vielen als das „Enfant Terrible“ der heutigen Gesellschaft. Sie sind aber auch Wirtschaftsfaktor, Lifestyle, Kulturgut und Kunst. Insofern also ein viel versprechendes Spannungsfeld.

Linda Breitlauch ist Professorin für Gamedesign und Studienleiterin an der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf. Sie beschäftigt sich seit 2000 mit der Forschung und Lehre zur Dramaturgie von Computerspielen, der Konzeption und Entwicklung von Computerspielgeschichten, e_Learning-Anwendungen und Serious Games.
Schon Sokrates wurde vorgeworfen, die Jugend zu verderben, dafür reichte man ihm den Schierlingsbecher. 2400 Jahre später sind Computerspiele das „Enfant terrible“ der Jugendverderbnis – „Killerspiele“ und „Spielsucht“ bilden begrifflich die Speerspitze der gesellschaftlichen Anklage. Getragen und betrieben wird die Diskussion insbesondere durch die so genannten „klassischen“ Medien, denen die Schelte jedoch aus eigener Vergangenheit und Erfahrung leidlich bekannt vorkommen sollte. In der kurzen Zeit ihrer Entwicklung hat die Branche viele Höhen und Tiefen miterlebt. Die Hysterie flaut langsam ab, Aufklärung wird betrieben. Auch die Politik erkennt den Wirtschaftsfaktor des boomenden Marktes. Der Rauch verzieht sich allmählich. Zeit sich zu fragen: Wo kommen wir her, wo stehen wir heute und wo werden wir in zehn Jahren sein?
Die Art des Medienkonsums, mit dem Menschen einer Generation aufwachsen, verbindet sie auch miteinander: ob Kinofilme oder Fernsehserien, ob unterschiedliche Mode- oder Musiktrends – all das sind prägende Erlebnisse, die sich mit dem eigenen Leben untrennbar verbinden. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wuchs eine Generation auf mit „Pong“, „Space Invaders“ und „Monkey Island“ und erschuf sich dabei ebenfalls gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen. Medienerlebnisse bilden unsichtbare Kultgemeinschaften. Medienpädagogen und „Computerspielphilosophen“ sprechen in diesem Zusammenhang von einer generationenspezifischen Mediensozialisation.
Computerspiele prägen Gemeinschaften, so wie andere Medien auch. Sie sind ein bedeutender Teil der Unterhaltungskultur geworden. Und ebenso wie andere erfolgreiche Unterhaltungsformate vor ihnen stehen nun auch Computerspiele unter dem Verdacht, zur Verdummung, Verrohung oder Aggressionsförderung vor allem junger Menschen beizutragen.
Bestehende und zum Teil auch berechtigte Bedenken gegenüber diesem Unterhaltungsformat haben zu einem großen Teil mit Ängsten gegenüber einem möglichen Verlust des Wirklichkeitsbezuges beim Spieler zu tun, entspringen aber auch einer ernsthaften Unwissenheit vieler Erziehungsverantwortlicher gegenüber diesem noch relativ jungen Medium.
Für die Generationen, die nicht mit dem Computerspiel sozialisiert wurden, bilden die so genannten klassischen Medien - insbesondere das derzeitige Leitmedium Fernsehen - das maßgebliche Sprachrohr der in die Öffentlichkeit getragenen Befürchtungen.
Dies ist durchaus verständlich aus dem Blickwinkel der so genannten klassischen Medien aufgrund einer möglichen Konkurrenzsituation, welche mit der heranwachsenden Computergeneration einzieht und sichere Einschaltquoten traditioneller Medien ernsthaft zu bedrohen scheint: Laut einer Studie zum durchschnittlichen Medienkonsum der EIAA (2008) verbringen 16-24-jährige inzwischen erstmals mehr Zeit online oder mit Computerspielen als vor dem Fernseher. Die Hysterie einiger Fernsehformate bei der zum Teil verfälschten und monokausalen Darstellung der Gefahren von Computerspielen könnte also durchaus in rein ökonomischen Interessen begründet liegen – die klassisch sozialisierten Generationen sind die Eltern der Heranwachsenden und somit diejenigen, die mit Verboten und Diffamierungen den bevorstehenden Einbruch an Zuschauerzahlen möglicherweise noch ändern könnten. Fraglich ist jedoch, ob nicht neue Formate das ohnehin kaum noch aufzuhaltende Zusammenwachsen von Spielen, Internet und klassischen Medien nicht auch ein enormes Potenzial für klassische Medien darstellen. Noch eher zaghaft wagen sich TV-Formate an die Ausweitung ihrer Angebote auf die neuen Medien, stellen beispielsweise ihre Sendungen als Podcasts ins Netz oder entwickeln Games zu ihren Fernsehformaten. Eine signifikante Entwicklung, die sich höchstwahrscheinlich noch beschleunigen wird. Denn im Vergleich zu anderen Künsten und Unterhaltungsformaten haben sich Computerspiele in vergleichsweise kurzer Zeit zu einem nicht mehr weg zu diskutierenden Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Zum Lifestyle gehören Games schon lange, und sie ziehen sogar in die Werbung und andere klassische Medien ein – wenn auch zumeist noch als Persiflage oder Hommage an die Klassiker aus den frühesten Tagen des Videospiels.
Außerdem werden Computerspiele nun auch noch als Kulturgut angesehen und sind damit sozusagen von Staats wegen förderwürdig, paradoxerweise während gleichzeitig von Seiten einiger Betroffenheitspolitiker Rufe nach noch mehr und noch strengeren Verboten gegen spezielle Ausprägungen des Mediums noch immer nicht verstummen.
Während Computerspiele also einerseits noch ein Politikum sind, wurden die Potenziale des Spiels, die insbesondere in Lernprozessen nachweislich wirksam sind, längst erkannt. Spielprinzipien für etwas anderes zu nutzen, für etwas „Ernsthaftes“, ist zudem politisch korrekt, sinnvoll im Beruf einsetzbar und somit auch für branchenferne Institutionen interessant, bieten also ein enormes Wertschöpfungspotenzial. Diese Facette repräsentiert eine Entwicklung, die langfristig gesehen die Spielebranche in Deutschland endgültig gesellschaftsfähig machen dürfte.
Serious Games
Spielregeln sind älter als die ältesten Gesetze der Welt. Deshalb sind Spiele das einzige, was Männer wirklich ernst nehmen. (Peter Bamm)
Die bisher eher negativ geprägte öffentliche Wahrnehmung des Computerspiels treibt Forscher und Entwickler immer wieder in Erklärungsnöte bezüglich der guten Absichten ihrer Tätigkeit. Deshalb werden Wirkungen von Computerspielen in erster Linie als Auswirkungen auf jemanden oder etwas wahrgenommen und untersucht. Erwiesenermaßen positive Wirkungen von Computerspielen werden überwiegend im Hinblick auf die Beförderung anderer Inhalte diskutiert, beispielsweise im Bereich des „Game based Learning“ oder im Edutainment-Bereich (unterhaltsame Lernspiele für Kinder und Jugendliche).
Das neue Schlagwort der Branche heißt also „Serious Games“ - ernsthafte Spiele. Sie stellen unter den Spielegattungen das dar, was Dokumentarfilme bei Filmgattungen auszeichnet: einen gewissen glaubwürdig darstellbaren Bezug zur Wirklichkeit sowie eine bestimmte Authentizität - dies wird offenbar von beiden Gattungen erwartet.
Serious Games sind also Computerspiele, die in gewisser Weise authentisch sein wollen. Das kann ein historischer Aspekt sein - also tatsächliche Geschichte - oder auch Alltägliches. Letztlich beanspruchen solche Konzepte hinsichtlich Logik, Chronologie oder Physik im Zusammenhang mit dem, was auf die Wirklichkeit übertragbar sein soll, unbedingte Authentizität. Was sich diesem Anspruch unterwirft, benennt der Produzent in der Regel selbst und stellt sein Produkt im Hinblick auf einen entsprechenden Übertragungswert dar.
Diese Spiele versprechen also, dass der Spieler etwas lernen kann, was man auch im so genannten wirklichen Leben gebrauchen und anwenden kann – und das möglicherweise sogar besser, als man es mit traditionellen Lernszenarien erreichen könnte. Spiele motivieren, weil sie ihre Lernherausforderungen mit spielerischen Wettbewerbsszenarien verknüpfen - und das können sie in allen didaktischen Szenarien liefern. „Drill- and Practice“ - Methoden beispielsweise stellen sich in konventionellen Lernszenarien (Vokabeln oder Tippen lernen) oft als mühsam und langweilig dar – das Spiel hingegen eignet sich hervorragend als Lernmedium. Nichts anderes als Drill-and-Practice-Methodik war das Spiel „Mohrhuhn“ – ein Szenario, das vom Spieler nichts anderes abverlangte als in einer begrenzten Zeit eine besonders hohe Interaktionsfrequenz zu erreichen. Langweilig? – keineswegs.
Fromme und Meder sprechen in ihrem Beitrag zur Mediendiskussion die Faszination vom Entdecken virtueller Welten an. Sie benennen dabei folgende Kategorien:
• Die „Andere Welt“ zeichnet sich aus durch eine "Lust am Ungewissen und an der Unwirklichkeit". Hier herrschen andere zeitliche und räumliche Bestimmungen als im wirklichen Leben. Spieler können Gesetzmäßigkeiten der unwirklichen, nach völlig anderen Regeln konzipierten Welt erproben.
• Die „Ähnliche Welt“ bietet ähnliche Bedingungen und Regeln wie die wirkliche Welt. Hier entsteht Freude am Entdecken der Übergänge von der wirklichen zur erdachten Welt, sowie
• die „Gleiche Welt“ – sie bietet mehr als alle anderen die Möglichkeit des Probehandelns. Mit diesen Szenarien können Lösungs- und Bewältigungsstrategien der wirklichen Welt eingeübt werden, ohne dass der Spieler im wirklichen Leben dafür sanktioniert wird. Man kann gewisse Gesetzmäßigkeiten der wirklichen Welt erproben und im besten Falle später nutzen. Insbesondere solche Szenarien werden mit „Serious Games“ abgebildet.
Gerade der Bereich der Simulationen, welche anhand von Gesetzmäßigkeiten der wirklichen Welt, zumeist auf ein definiertes Wesentliches abstrahiert dargestellt werden, bilden schon lange solche „ernsthaften“ Szenarien ab. Flug- und Kriegssimulationen gibt es bereits seit Beginn der Spieleentwicklung, gingen ihr sogar voraus. So soll bereits im Jahre 1955, bei der Research Analysis Corporation in Virginia, das erste Kriegsspielszenario - Nato gegen die USSR – auf einem Großrechner entwickelt worden sein. Simulationen erklären Epidemieszenarien, in denen die Ausbreitung von möglichen Krankheitserregern modellhaft inszeniert wird. Simulationen können Erkenntnisse darüber liefern, wie man in einem Ernstfall Katastrophen wirksam gegensteuern könnte. Sie können dabei helfen, schwierige Situationen gefahrlos zu trainieren, um im wirklichen Leben besser auf sie vorbereitet sein zu können.
Spiele bieten die Möglichkeit des Probehandelns, des gefahrlosen Ausprobierens verschiedener Strategien, ohne dass sich daraus bereits direkte Konsequenzen für das wirkliche Leben ergeben. Entscheidend ist für diese Variante des Probehandelns, dass die Folgen – also sowohl Gewinn als auch Verlust – keine Konsequenzen für Leib und Leben des Spielers haben müssen.
Wenn also Übertragungen von der Spielwelt in die wirkliche Welt möglich sind – und darauf zielen Serious Games letztlich ab – wenn sie helfen können, etwas einzuüben, dann stellt sich aber auch die Frage: Kann man mit ihnen nicht zum Beispiel auch „richtiges“ Schießen trainieren?
Nun - wenn die Eingabegeräte real simuliert und Force-Feedbacks realistisch auf das Eingabegerät übertragen würden, und wenn auch Ballistik, Schusswirkung usw. authentisch wären – ja, dann schon. Genau das trainiert man aber wenn überhaupt auf einem Schießstand, beispielsweise im Schützenverein. Nicht jedoch an einer Konsole, nicht mit einer Maus, nicht mit einem Joystick. In einem Shooter wird die Hand-Augen-Koordination trainiert, was beispielsweise für Chirurgen eine wichtige motorische Fähigkeit darstellt. Das kann ein Shooter leisten - aber das will ein Shooter gar nicht.
Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass es so genannte „Killerspiele“ auch unter den Serious Games gibt: „Re-Mission“ beispielsweise, ein Spiel, in dem der Spieler als Miniroboter „Roxxy“ Krebszellen mit Chemomedizin beschießt, gleichzeitig aber die Immunzellen am „Leben“ lassen muss – ein Räuber und Gendarm – Spiel für krebskranke Kinder mit überaus sinnvollem und pädagogisch wertvollem Einsatzgebiet.
Re-Mission: ein Spiel für krebskranke Kinder. Als Miniroboter kann man Krebszellen im Körper abschießen und sich so die Wirkungsweise der notwendigen Medikamente verdeutlichen. http://www.re-mission.net
Aggression und Sucht
Shooter – das ist das Genre, das im wahrsten Sinne des Wortes den „Shooting-Star“ der Branche bildet und innerhalb der so genannten „Killerspieldebatte“ als Aufhänger für nachhaltige Kritik am ganzen Medium darstellt. In diesem Zusammenhang sei auf eine aktuelle Studie verwiesen, welche die polemische Darstellung dieser Debatte und die Reaktion der Spieler darauf explizit untersucht. Sie zeigt deutlich die bewusste Ignoranz der konventionellen Medien und stellt unmissverständlich dar, dass derzeit fast ausschließlich die Games-Fachpresse (insbesondere die GameStar) auf die Argumentationen der Spieler eingeht. Als Fazit formulieren die Autoren zutreffend: „Das Gefühl der Diskriminierung und der Ohnmacht über die fehlende Präsenz der eigenen Position ist [...] ernst zu nehmen, wenn eine Debatte über den Umgang mit Spielen in unserer Gesellschaft Erfolg haben soll.“
Dennoch bleibt noch immer die Frage offen, warum es eigentlich Spaß macht, solche Spiele zu spielen.
Der Kommunikationswissenschaftler Peter Vorderer argumentiert evolutionswissenschaftlich und begründet, dass Spiele – auch gewalttätige – nötig seien, weil sich der zivilisierte Mensch in der Gesellschaft Aggressionen nicht mehr leisten muss. Aggressionen sind weder gesellschaftsfähig, noch notwendig – zumindest nicht in seiner archaischsten Form - töten, um zu überleben beispielsweise. Eine Notwendigkeit, die zu Kriegs- und Nachkriegszeiten eingefordert wird, nicht jedoch in zivilisierten, friedlichen Gesellschaften. Somit könnten Shooter ein einfaches Ventil für natürliche Instinkte darstellen.
Denn Spielewelten sprechen durchaus archaische Triebe an. Zu diesen gehören aber auch Heldenmut, Mitleid und Moral. Nicht umsonst finden viele Spiele in Fantasywelten statt, in denen es möglich ist, stundenlang durch „unberührte“ Landschaften zu wandeln (wo kann man das heute noch?), zu zaubern und mit mittelalterlichen Waffen den Nahkampf zu suchen.
Auch in einem „Shooter“ spielt man zumeist den GUTEN! – was immer das heißen mag. Den Soldaten oder den Wissenschaftler, der beauftragt wurde, die Welt zu retten, finden wir oft in diesen Spielen – genau wie im Kino. Dort wiederum findet man sogar noch mehr: Figuren nämlich, die aus Eigennutz und mit moralisch äußerst unlauteren Motiven wie der Selbstbereicherung agieren, werden uns im Kino weit häufiger als Identifikationsfiguren präsentiert, als das im Spiel der Fall ist. Die „Heldin“ aus Kill Bill, die eine Mutter vor den Augen ihres Kindes umbringt? – Motiv: Rache. Die gnadenlos hinrichtenden „Helden“ aus „Pulp Fiction“? Motiv: nur ein Job, der Spaß macht. Mitleidlosigkeit als Identifikationspotenzial.
Auf solche Szenarien trifft man im Spiel äußerst selten. Die Erzeugung von Identifikation mit einer Figur, die aufgrund „unethischer“, also eigennütziger Motive handelt, finden durchaus statt – beispielsweise in „Max Payne“. Dort spielt der Spieler eine Figur, die von Rachegefühlen angetrieben wird – wenngleich durch nachvollziehbare. Doch fast immer werden Angriffe oder Übergriffe auf so genannte „Unschuldige“ im Spiel bestraft, wie z.B. in „Hitman“. Der ist zwar ein gefühlloser Klon, dennoch darf er keine Unbeteiligten töten. Die „Bestrafungen“ sind Punktabzug oder das Scheitern der Mission.
Pete Molineux, der berühmte britische Spielentwickler („Populous“, „Black & White“ u.a.) ist von der Idee ergriffen, dem Spieler selbst zu überlassen, ob der „gut“ oder „böse“ sein möchte. Er stellt es dem Spieler frei, in einer dunklen oder einer hellen Spielwelt zu interagieren. Er verbindet bewusst keine moralische Bestrafung mit der Entscheidung des Spielers, auf der „dunklen Seite“ zu stehen, indem das Spiel verloren wird. Doch er lässt die anderen Figuren auf die Entscheidung des Spielers reagieren. Der Verräter wird gemieden, aber belohnt; der Gnadenlose gehasst, aber gefürchtet; der Helfer geehrt, aber hintergangen.
Ist das nicht eigentliche Aufklärung? Wir können uns frei entscheiden – wie im wirklichen Leben auch. Denn auch dort verliert man nicht unbedingt, wenn man egoistisch und eigennützig handelt, man könnte fast sagen: eher das Gegenteil ist der Fall. Warum sollte man im Spiel nicht einfach ausprobieren können, was passiert, wenn man einfach mal jemand anderer sein kann? Und das alles, ohne dass man in der Realität tatsächlich ein anderer sein möchte. Ein Spiel kann das „Was-wäre-wenn“ in unserem Leben abbilden und lehrt uns möglicherweise, dass wir eigentlich alles richtig machen, dass unserer Kulturkreis und unsere Lebensart durchaus lebbare Werte bietet.
Jedoch liegt hier auch die Gefahr der Flucht für diejenigen, die sich im „Was-wäre- wenn“ verlieren. Solche, die ihre Identität im virtuellen Raum akzeptabler, wünschenswerter finden als ihre Identität im wirklichen Leben. Und die in dieser Welt das ausleben können, was ihnen die wirkliche Welt nicht bietet: Anerkennung, Respekt, gar Liebe. Dann wird das Probehandeln zum wirklichen Handeln, dann übernehmen das Spielerlebnis und die virtuelle Gemeinschaft die Aufgabe der wirklichen. Hier ist die Gefahr der Abhängigkeit von „scheinbaren“ Belohnungen offenbar, welche in der Spielumgebung leichter zu erreichen und offensichtlicher zu erkennen ist, als im wirklichen Leben. Und dieser Gefahr müssen sich auch die Produzenten stellen. Aber ebenso auch die Gesellschaft, wenn sie den jungen Menschen diese Anerkennung offenbar nicht bieten können.
Eigentlich alles nichts Neues – Theater, Literatur und natürlich Filme – sie alle wurden in „ihrer“ Zeit, als auch sie noch die „neuen“ Medien waren, mit denselben Vorwürfen konfrontiert und mussten sich ihnen in einem eben so mühsamen Prozess stellen. Heutzutage ist beispielsweise Fernsehsucht kein neues Phänomen, sondern nur ein weggeschwiegenes. Verantwortung? – Fehlanzeige. Mit solchen Diskussionen lassen sich ja auch keine Wählerstimmen mobilisieren.
Die Spielebranche hingegen regt sich. Blizzard und Sony bieten beispielsweise ein Elternmenü an, in dem festgelegt werden kann, wann und wie lange ihre Kinder spielen dürfen. Auch In-Game-Restriktionen werden diskutiert und zum Teil schon durchgeführt – angeregt durch die Erfahrung in China, wo die Zahl der jugendlichen Spieleabhängigen auf 2,4 Mio. geschätzt wird. So werden nach einigen Stunden Spielzeit Erfahrungspunkte heruntergesetzt. Viele andere Möglichkeiten wären denkbar – Spielfiguren, die müde werden, virtuelle Städte, die nachts abgeschlossen werden, usw. Aber dass Entwickler ihre Spiele mit Absicht langweilig machen, kann man natürlich nicht ernsthaft verlangen.
“I’m still alive!” („Boss“ in Portal)
Der Onlinespielebereich in Deutschland wächst unaufhörlich, Mobile- und Serious Games werden erfolgreich aus den branchenfremden Industrien direkt unterstützt. Die großen Triple-A-Titel jedoch werden bis auf wenige Ausnahmen im Ausland – also nicht in Deutschland produziert.
Rückblickend lässt sich sagen, dass ohne Spieltechnologie die technologische Entwicklung von Computern sicher anders verlaufen wäre. Denn wer braucht schon eine überirdisch schnelle Grafikkarte für die Ausführung eines Officeprogramms?
Fotorealismus ist zwar keine notwendige Bedingung für gute Spiele, sondern auch die Geschichte, das Gameplay, die Herausforderung, die Identifikation, die Immersion. Die Qualität der Geschichten kann auch mit weniger technischem Aufwand erreicht werden. Dennoch wird sich der Standard der grafischen Entwicklung wohl irgendwann auf dem Niveau des Realtime Raytracing-Verfahren einpendeln. Ästhetiken, die Spiele als Kunstform bestätigen werden, phantastische Geschichten, die an die antike Tradition des dramatischen Erzählens erinnern werden, Komik im Spiel, selbst gesteuertes und nachhaltigeres Lernen durch Spielprinzipien, die Vermischung und Konvergenz zu anderen Künsten, all dies kann Computerspielanwendungen in den nächsten Jahren zu einer anerkannten, möglicherweise zu der am weitest verbreiteten Kunst- und Unterhaltungsform überhaupt machen.
Computerspiele sollen Kulturgut werden, aber bitte nur die „Guten“, die anspruchsvollen. Was aber ist anspruchsvoll in den Augen einer Gesellschaft? „Crysis“ ist einer der wenigen Produktionen in Deutschland, mit der CryEngine konnte Crytek hohe internationale Anerkennung aufgrund der vielfältigen technologischen Entwicklungen in diesem Spielsystem erreichen. Aber „Crysis“ ist eben ein Shooter, und deshalb brüstet sich Deutschland nicht mit diesem Spiel. Warum verlieren die Premium Printmedien kein Wort darüber, dass Thomas Zeitner EA verlässt, während aber geneigte Leser wöchentlich die neuesten Eskapaden von Britney Spears oder Paris Hilton verfolgen können? Gamedesigner wie Pete Molineux oder Will Wright sind Popstars, fast überall auf der Welt – nur nicht in Deutschland. GTA 4 – Plakate hängen neben Kino- und Konzertplakaten – wo sehen wir die deutschen Produktionen an den Plakatwänden?
Und: Wird es in Deutschland jemals Popstars aus der Entwicklerbranche geben, einen „Dieter Bohlen“ oder eine „Heidi Klum“ der Entwicklerszene? – Warum nicht? Lasst uns Festivals und Stipendien ausrichten, öffentlich spielen, „Germanys next Programmiergenie“ und „Deutschland sucht den Superdesigner“ ausrufen! Nur sollten wir uns den Charme der Branche nicht ausreden, uns den Stempel der Konvention nicht allzu früh aufdrücken lassen.
Je selbstbewusster die Branche ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, desto mehr Gestaltungsspielraum bleibt ihr, sich, ihre Verantwortung und ihre Außenwirkung selbst zu definieren – bevor es andere für sie tun!
Literaturverzeichnis:
Wie beispielsweise der Medienwirkungsforscher Winfried Kaminski („Clash of Realities“ ) oder der Medienwissenschaftler Matthias Mertens („Wir waren Space Invaders“ )
Quelle: http://satundkabel.magnus.de/artikel/studie-junge-nutzen-internet-erstma....
Wie beispielsweise durch öffentlich-rechtliche Fernsehformate wie das ARD-Politmagazin “Monitor“ oder das ZDF-Magazin „Frontal 21“.
Beispielsweise zum Showformat „Germanys next Topmodel“, zu dem sowohl Offline- als auch Onlinegames vertrieben werden
In den Bundestag eingebrachter Antrag vom 15.11.2007 (Bundestagsdrucksache 16/7116), Computerspiele sollen zum Kulturgut erklärt und somit förderfähig erklärt werden.
Die Wirklichkeit unterscheidet sich – nach Fromme/Meder – von der Realität dadurch, dass sie objektiv vorhanden ist, während die Realität die subjektiv wahrgenommene Wirklichkeit darstellt. In der Wirklichkeit gegen einen Tisch zu laufen, kann in der individuellen Realität für den einen schmerzhafter sein als für den anderen.
Vgl. Fromme, Johannes und Meder, Norbert: „Bildung und Computerspiele: zum kreativen Umgang mit elektronischen Bildschirmspielen“, Virtuelle Welten ; 3, Leske + Budrich, Opladen, 2001
Oliver Klopfer und Michael Nagenborg: „Die "Killerspiel"- Debatte in der Wahrnehmung und im Urteil von Spielern“, 2008, unter http://www.mausbewegung.de.
Vorderer, P. and J. Bryant. „Playing video games: motives, responses and consequences.” Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, 2006.